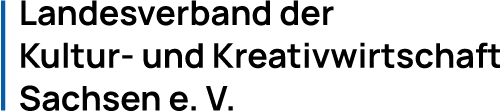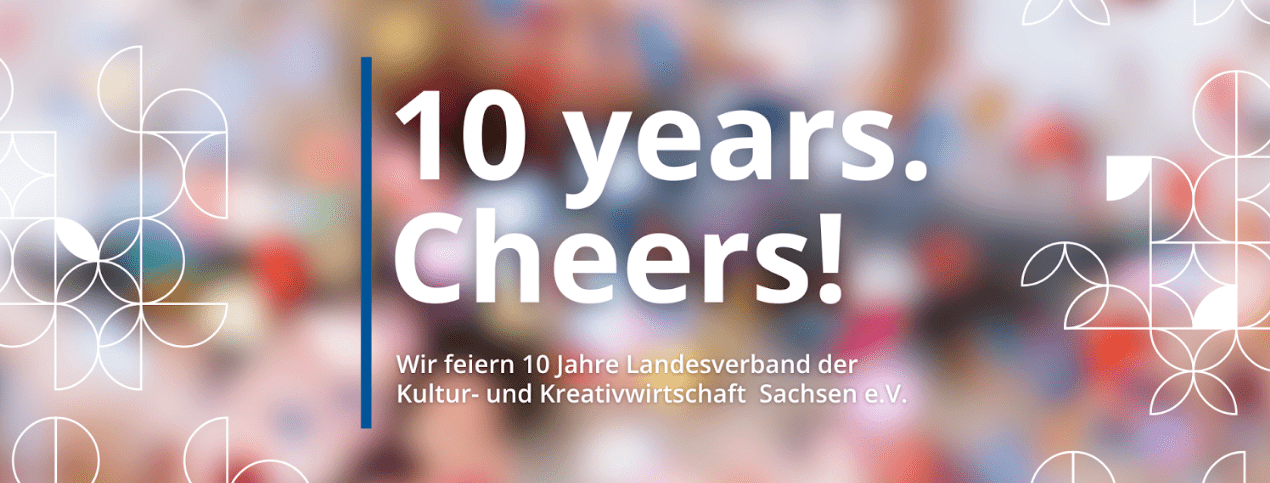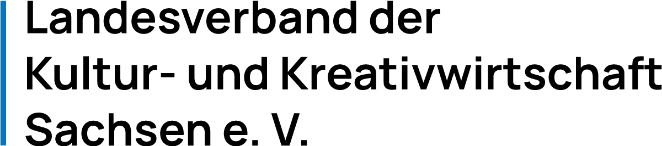Alex Pagel, Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V.
Foto: Screenshot Anhörung am 29.09.2025
Diese fachliche Stellungnahme ist im Zuge der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus am 29.09.2025 im Sächsischen Landtag vom Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V. erarbeitet und vorgetragen worden. Zum Video
Grundlage bildete der Antrag der Fraktion Die Linke „Clubkultur in Sachsen vor dem Aus schützen: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der kulturellen Vielfalt jetzt ergreifen!“
Fachliche Stellungnahme
Der breit gefächerte Musikmarkt war in besonderem Maße von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Zudem mussten bereits zuvor neue Absatzmärkte aufgrund der gravierenden Umsatzeinbrüche durch die Digitalisierung bzw. das Musikstreaming erschlossen werden. Der Landesverband hat aus diesem Grund dedizierte Programme zur Unterstützung und Stärkung der Musikwirtschaft und -kultur durchgeführt. Nicht zuletzt weil die Umsätze in diesem Teilmarkt auch für Sachsen nicht unerheblich sind und 2024 bei 296 Mio EUR lagen.
Daraus jüngst entstanden ist das „Büro für Popkultur und Musik Sachsen“, kurz BPM Sachsen, als landesweite Anlaufstelle zur Förderung der sächsischen Popkultur und Popularmusik. Es setzt die bisherigen Maßnahmen zur Unterstützung und Stärkung der Musikwirtschaft und -kultur in Sachsen fort und führt das Projekt POP IMPULS (12/2021-12/2024), gefördert vom SMWK und das Programm Branchenfokus POP von KREATIVES SACHSEN (10/2021-09/2025), gefördert vom SMWA, unter einem Dach zusammen.
Zentrales Ziel des BPM Sachsen ist die nachhaltige Professionalisierung der Popularmusik im Freistaat. Die Akteure der Szene sollen darin bestärkt werden, ihre künstlerischen und wirtschaftlichen Kompetenzen auszubauen, um langfristig stabile Strukturen und eine damit verbundene Wettbewerbsfähigkeit auf nationaler wie internationaler Ebene zu sichern.
Des Weiteren verfolgt das BPM Sachsen das Ziel, Netzwerke zu stärken und den Wissenstransfer zwischen verschiedenen Akteuren zu fördern. Durch die gezielte Verbindung von Musikschaffenden, Institutionen und Branchenvertretern sollen neue Kooperationen ermöglicht und Synergien geschaffen werden.
Zudem soll das BPM Sachsen einen Beitrag zur Steigerung der Sichtbarkeit der sächsischen Musikszene und -wirtschaft leisten. Die vielfältigen Akteure und Strukturen sollen sowohl innerhalb Sachsens als auch bundesweit und international sichtbar gemacht werden.
Im Folgenden ein vertiefender Blick in die Musikwirtschaft und Clubkultur:
Clubs und Livemusikspielstätten sind ein bedeutender Bestandteil innerhalb der Musikbranche. Dennoch war und ist die Musikwirtschaft in Sachsen, insbesondere im Konzert- und Clubbereich, stark von der Corona-Pandemie, der Inflation und weiteren derzeitigen Krisen betroffen. Trotz einer Erholung im Jahr 2022 liegen die Umsätze in vielen Bereichen weiterhin unter dem Niveau von 2019, insbesondere unter Berücksichtigung der Inflation. Steigende Betriebs-, Personal- und Energiekosten sowie erhöhte Preise für Equipment und Dienstleistungen belasten vor allem diesen Teil der Branche. Der Musikinstrumentenbau hingegen hat sich wieder erholt.
Als „Long Covid“ kristallisierte sich zudem heraus, dass eine ganze Generation heranwachsender junger Menschen nicht mit dem Thema Clubkultur vertraut gemacht wurde und bis heute als Gäste ausbleiben. Sie haben schlichtweg nicht gelernt und erlebt wegzugehen. Dabei fungiert ein Club gerade für diese Zielgruppe als wichtiger Ort zur Prägung der sozialen Kompetenz und Identität. Und das ohne dabei den Schutz eines sicheren Rahmens zu verlieren.
Musikclubs und Festivals (aber auch Proberäume) sind die Orte, an denen Karrieren starten.
Auch gelten Live-Auftritte durch den vorhin kurz beschriebenen Wandel des Musikmarkts mittlerweile als wichtigste Einnahmequelle für Musikschaffende.
Nachwuchskünstlerinnen und -künstler brauchen Bühnen, um erste Erfahrungen zu sammeln; Clubs und Festivals brauchen musikalische Acts für ihr Programm und um Publikum zu gewinnen; Netzwerke und Initiativen sorgen für Rahmenbedingungen, fachliche Unterstützung und Sichtbarkeit.
Wenn eine dieser Säulen wegbricht, gerät der gesamte Kreislauf ins Wanken. Nur im Zusammenspiel entsteht ein lebendiges, vielfältiges und so zukunftsfähiges Musikökosystem – vom Proberaum bis zur internationalen Bühne. Die Präsidentin des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft BDKV Sonia Simmenauer mahnte dazu jüngst:
„Die Erfolgsmeldungen der Top-Stars und großen Festivals können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das kleine und mittlere Geschäft an den gewaltigen Produktionskostensteigerungen zu zerbrechen droht. Das gefährdet uns alle, weil wir ein Ökosystem sind. Aus Nachwuchsacts im Club werden irgendwann Headliner.“
Dabei ist der finanzielle Spielraum im Clubbereich sowieso bereits gering. Dieser entsteht vor allem durch zu niedrige Einnahmen und zu hohe Betriebskosten. Die durchschnittliche Umsatzrendite liegt derzeit bei 3%, ab 5% spricht man von einem soliden Wert.
Wirtschaftliche Bedeutung & Tourismus
Trotz alledem sind Clubs und Livemusikspielstätten ein nicht marginaler direkter als auch indirekter Wirtschaftsfaktor. Sie schaffen Arbeitsplätze, generieren Einnahmen für die Kommune/Region und zahlen Steuern. Touristisch betrachtet spielt eine lebendige und vielfältige Nacht- und Clubkultur eine entscheidende Rolle für den Besuch einer Stadt bzw. Region und erhöht den Tourismus- und Anziehungsfaktor. Mit dieser Schwerpunktsetzung in der Kulturpolitik wurde Leipzig übrigens jüngst auch zur „Best Global Music City“ ausgezeichnet.
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Nachtökonomie wird mittlerweile jährlich auch in einer renommierten Bundeskonferenz, der „Stadt Nach 8”-Konferenz, mit über 500 Teilnehmenden besprochen. Im November 2026 wird diese erstmals in Sachsen, genauer gesagt in Leipzig, stattfinden.
Stadtentwicklung
Clubs spielen zudem eine zentrale Rolle bei der Stadtentwicklung und Revitalisierung von Stadtvierteln, die immer öfter auch im wissenschaftlichen Kontext betrachtet wird. (zB. Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO) Ihre Präsenz erhöht die Attraktivität einer Stadt für junge Menschen in der Bildungs- und Berufseinstiegs- phase. Somit wirken Clubs auch aktiv dem demografischen Wandel einer Region entgegen.
Soziokulturelle Funktion
Clubs dienen als soziale Treffpunkte und bieten Raum für Gemeinschaft und sozialen Austausch, der vor allem in einer zunehmend digitalen Welt wichtiger wird. Sie sind Orte, an denen sich Menschen mit ähnlichen Interessen treffen und neue soziale Kontakte knüpfen können.
Clubs sind ein Tummelplatz für die kreative Entwicklung und Exploration. Sie sind nicht nur Konsumorte, sondern oftmals Laboratorien für neue musikalische Strömungen, künstlerische Ausdrucksformen und Plattform zur Professionalisierung des musikalischen Nachwuchses.
Beitrag zur kulturellen Vielfalt
Clubs sind oft Orte der Vielfalt, oftmals auch der Inklusion. Sie bieten Raum für freien Ausdruck, unterschiedliche musikalische Genres, Szenen und Lebensstile. Durch das Zusammenbringen verschiedener Menschen fördern sie Toleranz und gegenseitiges Verständnis. Der Erhalt dieser Vielfalt ist ein wichtiger Bestandteil einer offenen und pluralistischen Gesellschaft.
All die genannten Punkte beschreiben die Dimension, die Clubs und Livemusikspielstätten somit auch in der sächsischen Kulturlandschaft einnehmen können.
Studien, wie u.a. „Der Wert von Musik” 2019, die Clubstudie des Bundes 2021 und die frisch veröffentlichte Festivalstudie des Bundes jetzt im September untermauern in ihrem jeweiligen regionalen Blick auf Sachsen, dass die Club- und Livemusikszene im Freistaat -zumindest noch- lebendig ist. Es ist daher umso wichtiger, diese Strukturen zu erhalten und zukunftsfähig zu machen. Nicht zuletzt auch wegen ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung für Stadt und Land.
Die bislang ergriffenen Maßnahmen zeigen, dass dies durchaus auch seitens der Politik vor allem im Zuge der Corona-Pandemie gesehen wurde. Staatliche Hilfsprogramme wie „Kulturerhalt” vom SMWK, das Sonderprogramm „Neustart Kultur“ des Bundes sowie 2024 der „Sonderpreis Nachtökonomie” im Wettbewerb Popmusik Sachsen mit Preisgeldern des SMWA boten hilfreiche Unterstützung.
Auch die Interessenvertretungen wie die Live Initiative Sachsen, das Klubnetz Dresden, das Kulturbündnis Hand in Hand Chemnitz und das LiveKommbinat Leipzig fungieren als wichtige Netzwerke, die aktuell ehrenamtlich die Bedarfe der Clubs und Livemusikspielstätten bündeln. Eine konzentrierte Koordinationsstelle, so wie sie derzeit in der Stadt Leipzig mit dem Nachtrat und dem Fachbeauftragten für Nachtkultur implementiert ist, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung und kann Vorbild für eine Entwicklung auf Landesebene sein.
Zusammenfassend ist zu betonen, dass der Antrag die Wichtigkeit der Clubkultur als essentiellen Bestandteil der kulturellen Identität Sachsens herausstellt. Einige der dort genannten Punkte spiegeln, dass Clubs und Livemusikspielstätten als wertvolle Kulturorte anzuerkennen und in ihrer Bedeutung im Bereich der Regionalentwicklung bis Nachwuchsförderung im musikalischen Bereich weiter zu fördern und auszubauen sind.
Ihre Unterstützung ist daher eine Investition in die kulturelle Vielfalt und die wirtschaftliche Zukunft des Freistaates.
Notiz: Der Wortlaut für den Webartikel wurde sprachlich leicht angepasst, inhaltlich bleibt die Stellungnahme unverändert.
Sachkundige: Alex Pagel, Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V.
Ähnliche Beiträge